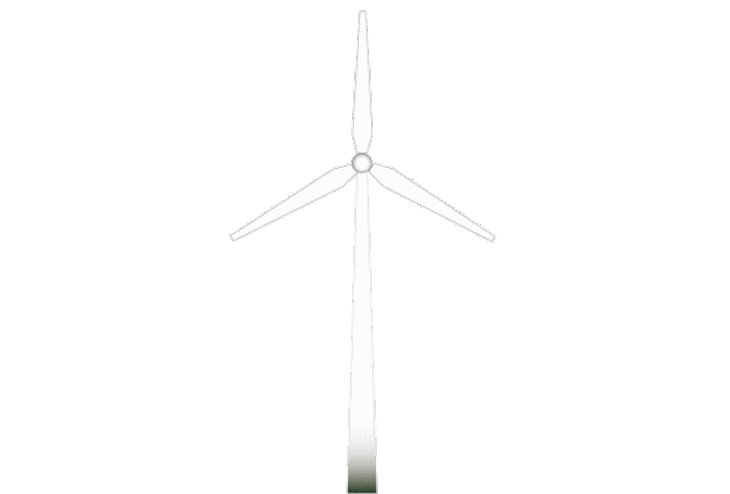Die Offshore-Windenergie nimmt eine zentrale Rolle im Ausbau der erneuerbaren Energien ein, um die Klimaziele zu erreichen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Deutschland und andere europäische Länder setzen daher verstärkt auf Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee, um klimaschonend Strom zu erzeugen.

1. Größe der Turbinen und Offshore-Windparks
In Deutschland sind aktuell (Stand erstes Halbjahr 2024) 29 Offshore-Windparks vollständig in Betrieb, wobei der Großteil davon in der Nordsee liegt.(1)
Die einzelnen Offshore-Anlagen sind gigantische Windturbinen, die in Zukunft noch größer werden sollen, um eine Leistung von acht Megawatt und mehr zu bringen. Planungen für zukünftige Projekte bis 2025 sehen deutliche Steigerungen gegenüber den Bestandsanlagen vor. Je nach Projekt kann der Rotordurchmesser dann zwischen 174 und 236 Meter betragen und die Nabenhöhe bei bis zu 145 Metern liegen. Zum Vergleich: Der Kölner Dom ist ca. 150 Meter hoch. Je nach Anzahl der Windturbinen benötigen die Windparks zurzeit eine Fläche zwischen 4 und 60 Quadratkilometern. Auch hier ein Vergleich: Die größte ostfriesische Insel Borkum ist rund 31 Quadratkilometer groß.
2. Der Lebenszyklus von Offshore-Windparks
Um die Auswirkungen von Offshore-Windparks auf die Meeresumwelt darzustellen, muss der gesamte Lebenszyklus der Anlagen betrachtet werden, der mit dem Meer in Zusammenhang steht. Also Anlieferung, Bau und Netzanbindung über Seekabel genauso wie Betrieb, Wartung und Rückbau. Gleichzeitig ist es wichtig zu bedenken, dass die Windturbinen ständigen, teils widrigen Wetter- und Umwelteinflüssen trotzen müssen: Korrosion durch Salzwasser, Druck und Bewegung durch Wellen sowie ständig wechselndes Wetter - Sonne, Regen und natürlich viel Wind. Das stellt hohe Anforderungen an die Stabilität und das verwendete Material.
Eine kurze Übersicht über die verschiedenen Einflussfelder:
Die Infrastruktur
- Großflächige Hafenanlagen und Lagerräume an der Küste sind nötig, um den Transport, die Installation, Inspektion und Instandhaltung sowie Stilllegung (Dekommissionierung) der Turbinen durch unterschiedliche Spezialschiffe zu gewährleisten. Während des gesamten Lebenszyklus der Windräder herrscht so ein stetiger Schiffsverkehr zwischen Küste und Offshore-Windparks, der den bestehenden Schiffsverkehr verstärkt.
- Der Strom muss an Land: Um den erzeugten Strom zu den Verbrauchern zu bringen, sind große Kabeltrassen notwendig, die u.a. im Weltnaturerbe Wattenmeer neu verlegt werden müssen. Für die Kabel ist es erforderlich, kilometerlange, tiefe Schächte zu graben. Ein gravierender Eingriff in die empfindlichen Ökosysteme.
Der Bau von Offshore-Anlagen
- Die mit der Montage der Turbinen einhergehenden Bauprozesse führen zu einer starken Geräuschbelastung über und unter Wasser.
- Mit dem Bau der Windanlagen wird die Struktur des Meeresbodens beeinflusst sowie Strömungsverhältnisse in der Wassersäule geändert.
- Die Verlegung von kilometerlangen Kabeln durch empfindliche Ökosysteme wie das Wattenmeer sowie der Baulärm stellen dabei eine besondere Herausforderung für Meereslebewesen dar.
Der Betrieb von Offshore-Anlagen
- Die Anlagen erzeugen während des Betriebs Geräusche, die sich als Vibration bis in das Fundament fortsetzen können und in die Umgebung abstrahlen.
- Zur Wartung und Kontrolle besteht ein stetiger Schiffsverkehr.
- Über und unter Wasser entstehen durch die Windturbinen neue Strukturen, die durch die Höhe und den Durchmesser der Turbinen viel Platz benötigen.
- Die Turbinen verändern dauerhaft Windfelder, Mikroklima und Meeresströmungen.
Der Rückbau von Anlagen
- Es entstehen ähnliche Störungen wie beim Bau von Anlagen - vor allem Lärm.
- Der Meeresboden wird erneut aufgewühlt und die Struktur verändert.
- Durch die Arbeiten steigt der Schiffsverkehr in der Region stark an.
Die Errichtung und Netzanbindung von Offshore-Windkraftanlagen beeinflussen also ebenso wie ihr Betrieb und schließlich ihr Rückbau die Lebensräume unterhalb und oberhalb der Meeresoberfläche. Die physikalischen, biogeochemischen und ökologischen Auswirkungen sind von unterschiedlicher Dauer, Intensität und räumlicher Ausdehnung. Die Folgen für die Lebewesen sind vielschichtig und können sogar für dieselbe Art in verschiedenen Windparks unterschiedlich ausfallen, positiv sowie negativ.
3. Physikalische und biogeochemische Veränderungen
Im Bereich der Windkraftanlagen ändern sich sowohl das Windfeld als auch lokale Klimabedingungen. Das hat wiederum Effekte auf das Meer, etwa indem die windgetriebene Durchmischung des Oberflächenwassers gehemmt und damit die Schichtung des Wassers verändert werden kann. Doch die Windturbinen stellen nicht nur ein Hindernis für die Luftströmung dar. Sie verändern auch die Wasserströmung und beeinflussen damit beispielsweise die Durchmischung der Wassermassen in tieferen Schichten.
Mit der Strömung können sich Wassertemperatur, Salzgehalt und die Verfügbarkeit von Pflanzennährstoffen ändern – und damit die Struktur und Funktionsweise mariner Ökosysteme beeinflusst werden. Zudem haben die veränderten Wasserströmungen Einfluss auf den Meeresboden. So können Sedimente aufgewirbelt oder verlagert werden, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften am und im Meeresboden.
Schadstoff-Emissionen durch Offshore-Windparks
Offshore-Windkraftanlagen müssen in einer rauen Meeresumgebung Jahrzehnte überdauern – daher werden unterschiedliche Strategien angewandt, um die verschiedenen Bauteile gegen Verwitterung zu schützen. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz von Korrosionsschutzmitteln und Bioziden, die zur Vermeidung von Bewuchs auf den Fundamenten eingesetzt werden.
In Deutschland werden strikte Umweltanforderungen an Offshore-Installationen gestellt: Diese beinhalten den Einsatz von Schutzmitteln, die das niedrigstmögliche Niveau an Schadstoffen aufweisen. Einige giftige Bestandteile sind außerdem gänzlich verboten. Dennoch können beispielsweise bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten Schadstoffe aus Beschichtungsmaterialien freigesetzt werden, in die Meeresumwelt gelangen und marine Ökosysteme beeinflussen. Zudem verursachen der gesteigerte Schiffsverkehr und die damit verbundenen Abgase zusätzliche Umweltbelastungen.
4. Ökologische Veränderungen
Über der Wasseroberfläche
Aktuell ragen Offshore-Windanlagen bis zur Rotorspitze bis zu 150 Meter aus dem Meer heraus, der Durchmesser des Rotorsterns beträgt 125 Meter - ein beträchtliches Hindernis über dem Meeresspiegel. Künftige Anlagen werden diese Ausmaße noch deutlich übersteigen. Die Folgen für Seevögel, Zugvögel und Fledermäuse sind vergleichsweise gut untersucht. Sie variieren allerdings je nach Standort und Tierart.
Die Hauptgefahren für Vögel und Fledermäuse sind dabei Kollisionen mit den Rotorblättern sowie ein Verlust des Lebensraums. Wandernde Zugvögel fliegen auf ihren Migrationsrouten über Nord- und Ostsee häufig unterhalb von 300 Metern und damit genau in Turbinenhöhe. Doch auch für Seevögel, die dauerhaft in den Gebieten rund um die Windkraftanlagen leben, besteht ein anhaltendes Kollisionsrisiko. Studien zeigen weiterhin, dass verschiedene Seevogelarten die Windparks meiden und somit wichtige Nahrungsgebiete verlieren.
In dem Zusammenhang ist der Standort eine zentraler Faktor. Beispielsweise ist die Kollisionsgefahr sehr viel höher, wenn die Windanlagen in wichtigen Flugrouten der Zugvögel stehen oder in der Nähe von Gebieten liegen, in denen Seevögel rasten und brüten. Das sollte in die Standortauswahl einfließen. Weiterhin gibt es als Lösungsvorschlag den Ansatz, die Windkraftanlagen zu bestimmten Tageszeiten oder saisonal abzuschalten - etwa während des Vogelzugs - um das Kollisionsrisiko zu minimieren. Dazu sind genaue Kenntnisse über Flugrouten und -zeiten notwendig, die laufend aktualisiert werden.
In der Wassersäule
Die Auswirkungen von Offshore-Windkraftanlagen auf das Leben unter Wasser sind äußerst vielschichtig und von variabler Dauer sowie Intensität. Dabei lassen sich sowohl positive als auch negative Effekte auf verschiedene Ebenen des marinen Nahrungsnetzes beobachten.
Plankton, bestehend aus winzigen, umhertreibenden pflanzlichen und tierischen Organismen, stellt die Basis des marinen Nahrungsnetzes dar. Durch die künstlichen Hindernisse der Offshore-Windkraftanlagen werden Meeresströmungen verändert und der Meeresboden aufgewühlt. Dadurch ändert sich auch die Verteilung von Nährstoffen sowie der im Wasser schwimmenden Planktonorganismen. Windkraftturbinen wirken auch auf das Mikroklima und damit auf Temperatur, Niederschlag, oder Sonneneinstrahlung ein – diese Faktoren wiederum beeinflussen das Wachstum sowie die natürliche Verteilung von Plankton im Meer und damit ebenso die darauf aufbauenden Ebenen des marinen Nahrungsnetzes.

Weiterführende Informationen:
In der Forschungsmission sustainMare der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) untersuchen mehr als 250 Forschende in sieben Forschungsverbünden die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Nutzung und Belastung verschiedener Meeresregionen. Das Projekt Coastal Futures befasst sich dabei unter anderem mit Managementoptionen für Offshore-Windparks.
Die Folgen von Windparks für Fische
Der Lebensraum von Fischen wird durch die Offshore-Windparks stark umgestaltet. Großräumige Parks können die Wanderung von Fischen und damit ihre Populationsdynamik stören. Die Entwicklungsstadien, von der Fischlarve bis zum fortpflanzungsfähigen Tier, finden zum Teil in sehr unterschiedlichen Lebensräumen statt. Offshore-Windparks können beispielsweise dazu führen, dass einige Fischarten aus ihren angestammten Ablaichregionen vertrieben werden. Auch die ins Wasser abgegebenen Eier und Larven einiger Arten, die als Teil des Planktons umhertreiben, erreichen durch die veränderten Meeresströmungen mitunter ihre Kinderstuben in Küstennähe nicht mehr.
Entlang des gesamten Lebenszyklus der Anlagen werden außerdem Schall und elektromagnetische Strahlung abgegeben, die das Verhalten, die Kommunikation und Nahrungssuche der Fische, darunter auch Haie und Rochen, beeinträchtigen können. Auch Veränderungen des Mikroklimas, der Sedimentationsprozesse oder der Nährstoffkreisläufe können die Überlebenschancen einzelner Fischarten und Entwicklungsstadien einschränken.
Gleichzeitig stellen die Anlagen durch begrenzte Fischerei geschützte Unterwasserhabitate dar und können zur Regeneration von Fischbeständen und dem Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Dies kann sich wiederum positiv auf angrenzende Lebensräume im Meer auswirken und auch außerhalb der Anlagen zu einem Populationsanstieg verschiedener Fischarten führen.
Auch wenn die Fischerei in Windparks begrenzt ist - bestimmte Fischerei- und Aquakulturbetriebe wie Algenzucht lassen sich mit den Windparks verbinden. Das Absammeln von essbaren Meeresfrüchten wie Muscheln oder Krebsen aus dem Biofilm an den Fundamenten hat sich bereits in verschiedenen Ländern als wertvolle kommerzielle Einnahmequelle erwiesen und sorgt gleichzeitig dafür, die hydrodynamischen Belastungen der Anlagen regelmäßig zu verringern.
Die Folgen von Windparks für Meeressäuger
Die Effekte, die Offshore-Windkraftanalgen auf Meeressäuger wie Wale und Robben haben, können wiederum von Art zu Art variieren. Zu den betroffenen Arten in Nord- und Ostsee zählt auch der unter Schutz stehende Schweinswal, der in seinen Beständen in den deutschen Meeresgewässern bereits als stark gefährdet gilt. Räumliche Überschneidungen von in Planung oder Bau befindlichen Offshore-Windparks lassen die natürlichen Lebensräume der Schweinswale, in denen sie auf Nahrungssuche gehen oder ihre Kälber gebären, weiter schrumpfen und gefährden so, insbesondere während der Bauphase, die Populationen der kleinsten Walart.
Um den Unterwasserlärm zu mindern, werden mittlerweile Maßnahmen zum Lärmschutz ergriffen. Beispielsweise durch einen großen Blasenschleier. Dafür werden um die Rammstelle Luftschläuche gelegt, aus denen in regelmäßigen Abständen Luft ins Meer gepumpt wird, so dass ein Vorhang aus aufsteigenden Blasen entsteht. Die dämmen einen Teil des Schalls, zumindest während des Baus der Anlagen. Der Lärmpegel steigt in Windparks wie oben beschrieben allerdings dauerhaft an und strahlt in das umgebende Wasser sowie in den Meeresboden ab. Das kann das Verhalten, die Kommunikation, Navigation, Nahrungssuche und Fortpflanzung stören - alles lebenswichtige Funktionen für Arten wie Schweinswale, die auf die Echoortung angewiesen sind, um zu überleben.

Am Meeresboden
Beim Bau der Offshore-Windkraftanlagen wird der Meeresboden aufgewühlt und so die am und im Boden lebende Gemeinschaft (Benthos genannt) gestört. Viele der Benthos-Organismen können vor diesem Eingriff in ihren Lebensraum nicht fliehen, da sie überwiegend sessil (festsitzend) oder halb-sessil leben oder eine hohe Ortstreue aufweisen und sich nur langsam fortbewegen können.
Das Benthos in der Nordsee ist aber an einen dynamischen Lebensraum mit starken Strömungen und Stürmen gewöhnt – Studien haben daher gezeigt, dass sich benthische Tiere und Pflanzen nach Abschluss der Baggerarbeiten innerhalb weniger Jahre wieder in ihrem Lebensraum ansiedeln. Dennoch kann die Zusammensetzung der biologischen Gemeinschaft eine andere sein als zuvor: opportunistische, kurzlebige Arten, wie mobile Muscheln oder vielborstige Würmer dominieren die neue Gemeinschaft am Meeresboden. Zudem werden jene Arten, die auf feinen, sandigen Weichboden angewiesen sind, in unmittelbarer Nähe der Bauwerke dauerhaft verdrängt. Gleichzeitig profitieren jedoch auch dieselben Arten davon, dass Aktivitäten wie die Schleppnetzfischerei im Bereich der Windparks untersagt ist und sie so von weiteren bodenstörenden Aktivitäten teilweise verschont bleiben.
Fundamente der Windtürme bieten neue Lebensräume
Durch den Bau der Anlagen entstehen weiterhin neue Lebensräume. Das Fundament sowie der Turbinenturm bieten komplexe horizontale und vertikale Besiedlungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Organismen. Die biologischen Lebensgemeinschaften auf den Fundamenten sind sehr unterschiedlich zusammengesetzt und weisen regional und saisonal große Unterschiede auf. In den meisten Fällen dominieren jedoch einige Arten den Bewuchs, wie Muscheln, Rankenfußkrebse, Kolonien von Moostierchen sowie Schwämme, Anemonen und Nesseltiere. Gleichzeitig bieten die künstlichen Riffe auch gebietsfremden Arten die Möglichkeit, sich anzusiedeln und zu verbreiten.
Die Besiedlung der Fundamente oder auch der Turbinentürme ist aus ingenieurtechnischer Perspektive allerdings unerwünscht. Der Bewuchs belastet Struktur und Widerstandsfähigkeit der Materialien, erhöht den Instandhaltungsaufwand und kann die Funktionalität beeinträchtigen. Um den Bewuchs zu verhindern, werden häufig chemische Mittel eingesetzt: dabei handelt es sich beispielsweise um Lackierungen, die giftige Biozide enthalten können und so die Meeresumwelt schädigen.
Es gibt Lösungsansätze, wie die Einberechnung des Bewuchses in das Design der Anlagen, regelmäßiges Absammeln des Bewuchses oder die Installation einer Ring-Apparatur, die durch Wellenbewegung entlang der Fundamente auf und ab rotiert und so einen Bewuchs verhindert. Allerdings werden so mögliche positive Auswirkungen der Windanlagen auf die Meeresumgebung wie eine künstliche Riffbildung zunichte gemacht.
5. Offshore-Windparks - Orte vielfältiger Nutzung?
Der Ausbau der Offshore-Windenergie verschärft bereits bestehende Nutzungskonflikte zwischen verschiedenen Akteursgruppen in Nord- und Ostsee. Um die diversen Nutzungsanforderungen miteinander zu vereinen, wird eine höhere Flächeneffizienz benötigt. Das bedeutet einerseits, dass die gewonnene Energiemenge pro Fläche steigen muss, um gleichzeitig genügend Raum für geschützte Arten und Lebensräume, Schifffahrt, Fischerei und andere Nutzungsgruppen zu reservieren. Andererseits sollten die bereits einseitig genutzten Flächen bestmöglich mehreren verschiedenen Akteursgruppen zugänglich gemacht werden. Dabei spielen unterschiedliche Co- und Multi-Use-Konzepte eine wichtige Rolle. Auch der Austausch und Wechsel von genutzten Flächen zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen kann in Betracht gezogen werden, um ökologische Auswirkungen zu reduzieren. Wichtig dafür sind die effektive Meeresraumplanung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Modellierungen.
Aufgrund ihrer abgelegenen Lage - zumindest in der Nordsee - ist ein negativer Einfluss von Offshore-Windparks auf den Küstentourismus nicht zu erwarten. Im Gegenteil: indem Besucher:innen die Möglichkeit geboten wird, Anlagen aus der Nähe zu betrachten, können Offshore-Windparks auch als touristische Attraktion dienen und Einnahmen generieren.
1. Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) (2024). Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland. Erstes Halbjahr. Online Publikation.
2. ebenda, Seite 7
3. Bundesamt für Naturschutz (BfN), Offshore-Windkraft, zur Website